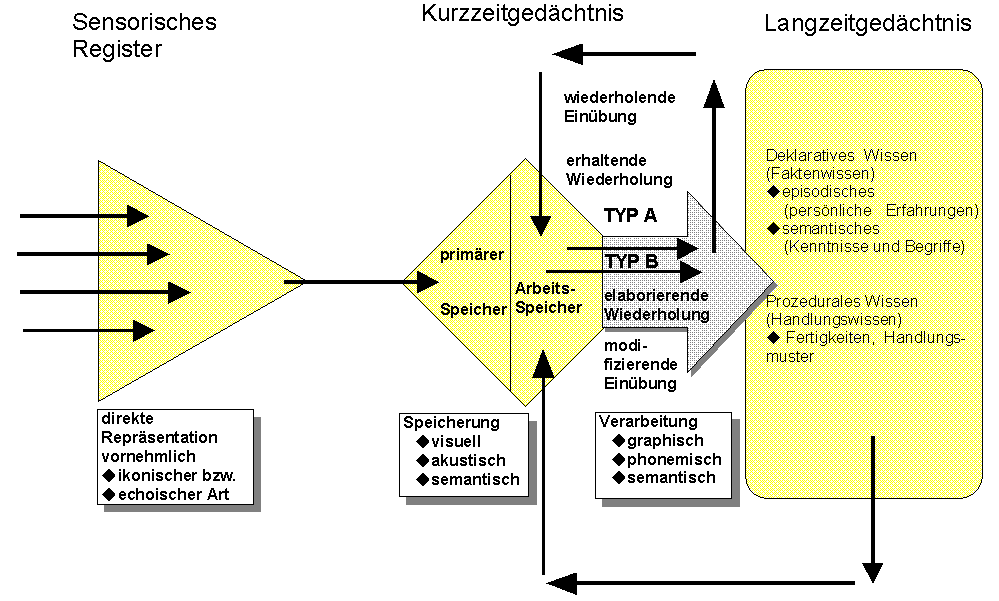
Lern- und gedächtnispsychologische Argumente für eine deutlichere Berücksichtigung der Versprachlichung im (Fach-)Unterricht
von
Werner Brandl M.A.
(Erweiterte Fassung eines Artikels, der unter dem Titel "Versprachlichung im Unterricht: Lern- und gedächtnispsychologische Aspekte" in schulmagazin 5 bis 10, Heft 3/97 erschienen ist).
Zurecht betonen moderne Unterrichtskonzeptionen neben einer offenen Strukturierung, dezidierter Handlungs- und Materialorientierung die Notwendigkeit der Veranschaulichung im Unterricht. Im Schulalltag wird dieser Forderung mit allerlei visueller Hilfestellung auch in sehr hohem Maße entsprochen, der Versprachlichung jedoch wird nicht immer der Stellenwert zugemessen, der ihr im Begriffsbildungsprozeß eigentlich zukommt: Dabei ist die Sprache nicht nur Begleiterin des Handelns, sie ist ebenso Mittlerin zwischen Handlung, ihrer bildhaften Vorstellung bzw. Ausdrucks und letztendlich das 'Material', in der sich die Resultate des Erkenntnisprozesses für zukünftige Handlungen aufbewahren lassen.
„Gedanken ohne Inhalte sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (KANT)
Zwei Phänomene: Allerorten und mit zunehmender Tendenz artikuliert sich Unbehagen mit der gängigen Erziehungs- und Unterrichtspraxis; sie sei zu 'kopflastig' , zu wenig 'handlungsorientiert' , nicht an der kindlichen Erfahrungswelt orientiert, kurz: zu seh r auf das Abstrakte ausgerichtet, das Konkrete im Leben lediglich streifend; und insofern insgesamt lebensfremd , nicht kindgemäß, gar kinderfeindlich.
Andererseits beklagt man das geringe sprachliche Ausdrucksvermögen unserer Schüler, deren Begeisterungsfähigkeit für eine Sache, Person oder Ereignis sich in den eindeutigen Adjektiven und den bekannten Steigerungsformen „ober-, über-,hyper-, mega-...“ s i ch im wahrsten Sinne als „restringierter Code“ 1) manifestiert. Was haben beide - auf den ersten Blick eigentlich disparaten - Phänomene miteinander zu tun?
Lassen wir uns von einem der Parteilichkeit unverdächtigen und unvoreingenommenen Zeitgenossen den Spiegel vorhalten:
„Sprache erwirbt man nicht, indem man Sprache hört und liest; Sprache erwirbt man, indem man sie selber hervorbringt. Radio Fernsehen, Video, Comics, Heftchen, Tonkonserven - all die damit verbrachte Zeit vergeht zwar nicht ganz sprachlos, aber sprachlich doch stark reduziert, und vor allem rein rezeptiv. In der Schule Lückentests (bei denen nur fehlende Wörter einzutragen sind), Multiple-Choice-Fragebögen (bei denen nur Antworten angekreuzt werden müssen), Ja-Nein-Fragen bis in die Universität und überhaup t eine nachlassende Neigung, den Schülern die Ausformulierung ganzer, »wohlgeformter« Sätze abzuverlangen - das könnte in der Tat sich gerächt haben. Denn nur die Sprache, die einer selber hervorbringt, kann in seinen Besitz übergehen“ (ZIMMER 1995, S. 22 ) . Und wenn die pädagogische Gewissenserforschung nur ansatzweise redlich ausfällt, kommen wir wohl um ein zustimmendes Kopfnicken nicht herum.
„Man lernt eher eine Sprache in der Küche als in der Schule“ 2)
Es muß die Frage erlaubt sein, ob das zu Beklagende -
üblicherweise dem massiven Einfluß der Medien und dem
Versagen der häuslichen Erziehungsgewalt zugeschrieben - nicht
auch zu einem nicht zu vernachlässigendem Teil hausgemacht, d.h.
Resultat des schuli schen Unterrichts- und Erziehungsprozesses sein
könnte.
Handlungsorientierung-na klar!
Veranschaulichung-aber immer!
Versprachlichung-?
Als Gegenstand schulpädagogischer Überlegungen wird die Versprachlichung gern unter den Aspekt den Veranschaulichung subsumiert:
„Ohne Zweifel ist das schon quantitativ bedeutsamste
Anschauungsmittel im Unterricht die menschliche Sprache. Und neben
diesem stehen dem Menschen noch sogenannte nonverbale
Kommunikationsmittel zur Verfügung, die Gestik und Mimik. Und
alle diese Kommunika tionsmittel sind unterrichtlich als
Anschauungsmittel nutzbar. Die durch eine spannende
Lehrererzählung über den »Prager Fenstersturz«
geschaffene Anschauung muß einer durch Bilder bewirkten nicht
nur nicht nachstehen, sondern ist ihr durchaus in vielem s o gar
überlegen“ (PETERSSEN 1994, S. 57). Als Kommunikations- und
damit 'Hilfs'mittel und Ersatz für fehlende Anschauung bzw.
theatralisches Element in der Unterrichtsgestaltung kann man sich die
Sprache gut vorstellen, deren Pflege getrost dem Fach überla ss
en, das sich nach der Muttersprache des Vaterlandes benennt, wo ja
mit den beiden Abteilungen mündlicher und schriftlicher
Sprachgebrauch quasi die natürliche Werkstatt des Erwerbs und
der Vervollkommnung von Oralität und Literalität - der
Mündlichkeit und Schriftlichkeit - benannt und in die Pflicht
genommen ist - und sich ansonsten den fachdidaktischen Raffinessen
zuwenden; so könnte man als advocatus diaboli die Szenerie in
den Schulstuben beschreiben; so daß die Möglichkeiten, die
die Sprache bietet, b ei weitem nicht ausgeschöpft werden,
sondern bedenklicherweise eher in ihren Funktionen im
Bildungsprozeß beschnitten wird.
Funktionen der Sprache
(4) argumentative Funktion
(3) Darstellungs-Funktion
(2) Signal-Funktion
(1) Ausdrucks-Funktion
(nach POPPER & ECCLES 1996, S. 86)
Die Ausdrucks-Funktion als die unterste Stufe der
Sprachproduktion, in der innere Zustände nach außen hin
vermittelt werden. Die darauf aufbauende Signal-Funktion, die der
Umwelt aufgrund verbaler Äußerungen eine Reaktion
abverlangt. Schließlich die Darste llungs- und argumentative
Funktion der Sprache, die es gestatten Sachverhalte zu beschreiben
und deren Notwendigkeit zu begründen.
Das Gedächtnis - viel Speicher und noch mehr Probleme
Sämtliche intellektuellen Bemühungen im Zusammenhang von Unterricht und Erziehung wären vergeblich, wenn sich das mühsam Erarbeitete nicht aufbewahren und zukünftig wieder verwerten ließe. Durch das Vorhandensein des Gedächtnisses erschließt sich dem M ens chen erst das Kontinuum von Vergangenheit-Gegenwart und Zukunft - und damit letztlich auch seine Identität. Und auch in diesem Zusammenhang spielt die Sprache eine erhebliche Rolle.
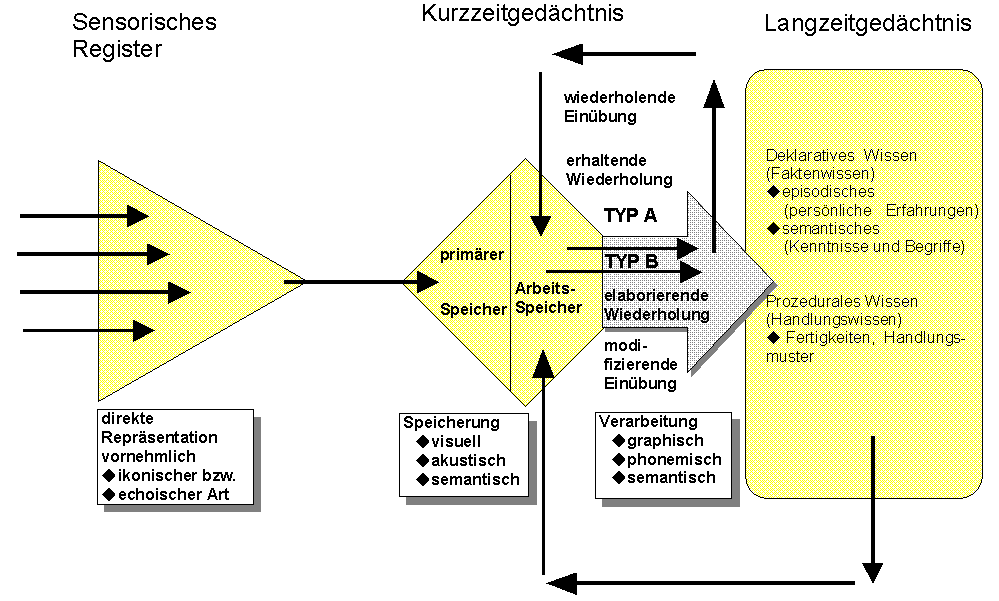
Abb. 1: Mehrspeicher-Modell des Gedächtnisses
Die Sinnesorgane nehmen ständig eine Fülle von Reizen auf, von denen jedoch nur ein sehr geringer Teil weiterverarbeitet wird, in die Sprache des Nervensystems übersetzt, dem Sensorischen Register als erster Verarbeitungsinstanz des Gedächtnisses zugeführt werden. Das sensorische Register bewahrt die Eindrücke -Töne, Bilder, Gerüche, Druck etc. - für einen äußerst flüchtigen Augenblick. Man geht davon aus, daß für jede Sinnesausprägung ein eigenes Register existiert: visuelle Informationen, die über das Aug e aufgenommen werden, finden sich demnach in einem visuellen Register wieder, analog akustische Reize, die der Gehörsinn aufnimmt, in einem akustischen Register. Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn verfügen über ähnliche Abschnitte im Register. „Unser Leit s inn ist in jeder Beziehung das Auge; was wir sehen, können wir bis ins letzte Detail analysieren, erinnern, vergleichen - die Voraussetzung für das Erkennen von Ähnlichkeiten.
Das Ohr hat eine vergleichbare Fähigkeit bei Sprachlauten, die auch recht gut konzeptualisierbar sind; sonst aber nicht durchweg.
Der Geschmackssinn ist außerordentlich leicht zu konzeptualisieren, aber er ist auch außerordentlich primitiv: Zunge und Gaumen vermitteln unserem Geist durch ihre chemischen Sensoren nur vier diskrete Qualitäten, »süß«, »salzig«, »bitter« und »sauer«.
Die eigentliche Geschmacksempfindung aber kommt mit Hilfe des Riechsinns zustande (wenn er bei einer Erkältung ausgeschaltet ist, schmecken wir so gut wie nichts). Den Geruch aber können wir nur ganz schwer und grob in seine Komponenten zerlegen, und an di ese können wir uns nur schwer erinnern - damit sind auch Vergleiche und Ähnlichkeitsbildungen kaum möglich. (...)
Beim Tastsinn und bei den Körperempfindungen, Schmerzen zum Beispiel, ist es nicht anders “ (ZIMMER 1995, S. 157). Das visuelle und auditive Gedächtnis dürfte jedoch mit seinen ikonischen und echoischen Repräsentationsformen überwiegen. Die wohl wichtigste Aufgabe des Sensorischen Registers bestehet darin, eine Reizgegebenheit als bedeutungshaltige Einheit zu identifizieren, z.B. als Buchstabe, Zahl, Satz, parallele Linien etc. zu erkennen; dies bezeichnet man deshalb auch als den Prozeß der Mustererkennu n g. Solchermaßen als bedeutsam erkannt, gelangen über die selektive Aufmerksamkeit diejenigen Sinneseindrücke in den eigentlichen Arbeitspeicher (working memory), der im Mehrspeicher-Modell unter dem Begriff des Kurzzeitgedächtnisses firmiert; dort findet d ie eigentliche Be- und Verarbeitung der Informationen statt, durch die erst eine Weitergabe und damit langfristige Speicherung im Langzeitgedächtnis ermöglicht wird. Das Kurzzeitgedächtnis hat eine im Vergleich zu den anderen Gedächtnisabteilungen äußers t begrenzte Kapazität (7 +/-2 Informationseinheiten) , mit der jedoch sämtliches Material, das ihm entweder aus dem Sensorischen Register, aber auch aus dem Langzeitgedächtnis übertragen wird, bearbeitet werden muß:
• Aufbereitung für die Langzeitspeicherung im
Langzeitgedächtnis und
• Abruf der Speicherinhalte aus dem Langzeitspeicher
„Information gelangt ins Kurzzeitgedächtnis in Form organisierter Bilder und Muster, die üblicherweise als vertraut und bedeutungstragend erkannt werden. Verbale Muster, die ins Kurzzeitgedächtnis gelangen, scheinen dort in akustischer Form aufbewahrt zu w erden - ihrem Klang entsprechend - selbst wenn sie durch die Augen und nicht durch die Ohren dorthin gelangt sind“ (ZIMBARDO 1992, S. 278).
Auf der „Werkbank“ werden die Informationen weiterverarbeitet:
Die erheblich geringere Kapazität des Arbeitsgedächtnisses macht es erforderlich, daß entsprechende Verarbeitungsmechanismen zum Einsatz kommen:
• Wiederholung: Typ A, die erhaltende
Wiederholung, hält die Informationen im Arbeitsgedächtnis,
verhindert das Vergessen durch die Hereinnahme neuer Informationen,
verlängert die Speicherzeit im Kurzzeitgedächtnis:
Wiederholen von Telefonnummern, Memorieren von Vokabeln etc. im
Stillen, aber auch durch lautes Aussprechen. Sie kann allerdings den
Übergang in das Langzeitgedächtnis nicht
gewährleisten. Dazu bedarf es des
Typs B, der elaborierenden Wiederholung, die mit
einer tiefergehenden Verarbeitung der Inf ormationen einhergeht: der
Sachverhalt wird logisch zergliedert, von unwesentlichen Aspekten
befreit, nach bestimmten Merkmalen geordnet, mit anderen
Sachverhalten verglichen, wesentliche Eigenschaften klassifiziert und
in abstrakter, vornehmlich sprachli c her Form
festgehalten.
• Chunking, d.h. das Zusammenfügen
mehrerer Informationseinheiten zu leichter speicherbaren
Informationskomplexen, z.B. indem eine Zahlenreihe durch eine
Zweiergruppierung unter die magische Grenze von 7+/-2
Informationseinheiten gelangt: 56 16 32 47 49; Rhy thmen in einer
Klangfolge bzw. Reime unterstützen ebenfalls das
Chunking.
„Die Sprache befreit uns zu einem hohen Ausmaß von der Tyrannei der Sinne“ (TEUBER)
„Die Sprache bringt Ordnung in Ereignisse, indem sie ihre Klassifizierung zuläßt, und sie liefert ein Werkzeug für die Darstellung abwesender Gegenstände und für ihre hypothetische Behandlung in unserem Geist. Wegen alldem erscheint es als wesentlich, daß ein zentraler Mechanismus vorhanden sein muß, um die Teilung zwischen den verschiedenen Sinnen zu überschreiten, um ein gefühltes Objekt durch ein gesehenes Objekt zu identifizieren und beides mit dem Objekt, das wir benennen können“ (TEUBER zit. nach POPP ER & ECCLES 1996, S. 372).
Gedächtnisinhalte, die an autobiographische Zusammenhänge gebunden sind, in denen ein Sachverhalt subjektive Bedeutsamkeit erlangt hat, ergeben das episodische Gedächtnis. Es repräsentiert die persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Dingen, Personen und Ere ignissen und steht in dieser Form auch nur dem Individuum zur Verfügung: Erinnerungen an den schönsten Urlaub, die größte Blamage in der Schule, aber auch die Erinnerung an den Geruch des Holzes in der Schreinerei zählt ebenso dazu.
„Analog sind in unserem Kopf all die vielen »Bilder« repräsentiert, die sichtbaren, aber auch die Hör-»Bilder«, die Fühl-»Bilder«, die Geruchs-»Bilder«, die Geschmacks-»Bilder«, kurz, die ganze sinnlich wahrgenommene Welt“ (ZIMMER 1995, S. 155).
Im semantischen Gedächtnis werden die grundlegenden Bedeutungen von Wörtern , Begriffen und deren Zusammenhänge in abstrakter Form gespeichert. Man geht inzwischen davon aus, daß die Speicherung solcher Gedächtnisinhalte auf der Basis von verbalen und visu ellen Codes vonstatten geht. „Nach dieser Auffassung ist es wahrscheinlicher, daß sensorische Informationen und konkrete Sätze als Bilder gespeichert werden, während abstrakte Sätze verbal kodiert werden“ (ZIMBARDO 1992, S. 286).
Episodisches und semantisches Gedächtnis beziehen sich auf die Speicherung des sog. deklarativen Wissens, auch als Faktenwissen benannt.
Das prozedurale Gedächtnis andererseits gestattet die Erinnerung an Fertigkeiten und Handlungsmuster, die zur Ausführung häufig wiederkehrender Tätigkeiten notwendig sind. „Fertigkeiten, wie Fahrradfahren oder die eigenen Schnürsenkel binden, sind schwer z u lernen, aber sogar noch schwerer zu vergessen“ (ZIMBARDO 1992, S. 282)
Was den Lernprozeß anbelangt, ist die Unterscheidung sowohl
nach unterschiedlichen Gedächtnisinstanzen (Sensorisches
Register, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis)
einerseits und die diversen Speicherformen (visuell, akustisch,
semantisch), Verarbeitung sebenen (graphisch, phonemisch, semantisch)
oder Gedächtnisinhalte (deklaratives Wissen in episodischer und
semantischer Form, prozedurales Wissen als Handlungswissen)
analytischen Gesichtspunkten der Erklärung des Phänomens
Gedächtnis geschuldet; konkret e Unterrichtsarbeit kann sich auf
die Betonung von Einzelaspekten nicht zurückziehen, sondern alle
Facetten mit einbeziehen; daß dabei die Forderung nach einem
Lernen mit allen Sinnen notwendigerweise einer starken verbalen
Komponente bedarf, damit das Wis s en langfristig verankert und auch
zur Verfügung steht, wenn es wieder benötigt wird,
dürfte offensichtlich sein. Neben der Berücksichtigung der
fundierenden Unterrichtsprinzipien der Ziel-, Sach- und
Schülerorientierung, der Betonung der regulierenden Un te
rrichtsgrundsätze wie Motivierung, Veranschaulichung, Sicherung,
Üben etc. ist es eine Erfordernis, daß auch wieder
verstärkt Wert gelegt wird auf eine Versprachlichung im
Unterricht, die eine Hilfe beim Aufbau der Wissensstrukturen wie bei
deren Abrufe n aus den Speicher darstellt.

Abb 2: E-I-S und die Bedeutung der Sprache
Insoweit dürfte auch einleuchten, daß der Versprachlichung als Unterrichtsprinzip ein den gesamten Fächerkanon umfassende Notwendigkeit zukommt, dem sich nicht nur Fächer mit relativ abstrakten Gegenständen wie der Mathematik oder Physik, oder wie im Falle Deutsch aus Gründen der offensichtlich inhaltlichen Vorgaben zuwenden, sondern auch die gerne als sog. 'praktisch-orientiert' eingeordneten Fächer Werken, Sport, Hauswirtschaft etc. nicht entziehen sollten. Die Fertigkeit des Knödel- resp. Klöße-Formens i m Hauswirtschaftsunterricht kann sich beispielsweise nicht im Zweischritt „Vormachen-Nachmachen“ und der verbalen Begleitung „Schau genau hin!“ erschöpfen; auch bei diesem Vorgang ist es wert und überdies notwendig, den Schüler zu genauer Versprachlichung hinzuführen und anzuhalten: Wie müssen die Hände geformt werden? Welche Vergleiche bieten sich an? (Schneeball formen vs. Tonkugel drehen). Wie läßt sich die Drehbewegung genau beschreiben? (Übrigens: So banal das Beispiel auch auf den ersten Blick ersche inen mag, der Leser möge sich selbst prüfen: Wie erfolgt die Drehbewegung beider Hände? Gegensinnig-gleichsinnig? Lösung unter Anmerkung 3)). Wie wird dasselbe in einem Kochbuch für den Haushalt bzw. für den Profi formuliert?
Oder Sport: Jeder kennt die Vorlagen zu den Bundesjugendspielen im Geräteturnen. Trotz Bebilderung und Benennung sind die Übungen so nicht unmittelbar erlern- und umsetzbar. Parallel zum tatsächlichen Vormachen durch den Sportlehrer bedarf es auch hier ein er genauen Versprachlichung, wie denn nun Handgriff, Schwungholen, Kraftübersetzung etc. etwa beim Felgaufschwung zu vorzunehmen sei.
Sosehr der Abstraktionsprozeß (vgl. Abb. 2) auf die Einhaltung der Abfolge der Darstellungsebenen (vom konkreten Operieren, sprich Handeln auf der enaktiven Stufe über bildhaftes Operieren auf der ikonischen Stufe zum vorstellenden Operieren auf der symbol ischen Stufe) zum Aufbau von Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen etc. unabdingbar ist, sosehr auch die tendenzielle Abnahme der konkreten Handlung und eine zunehmende Bedeutung der Sprache in diesem Kontext thematisiert wird, um so fraglicher ist, ob der B edeutung der Verbalisierung dadurch entsprochen wird, indem man sie eher unter dem Aspekt betrachtet, inwieweit und in welchem Umfang sie zur Unterstützung der einzelnen Darstellungsebenen mit einbezogen werden kann.
Die Mathematik-Didaktik hat, natürlich aufgrund der
immanenten sachlichen Notwendigkeit, schon stets darauf bestanden,
daß eigentlich jede Mathematik-Stunde gleichzeitig eine
Deutsch-Stunde zu sein habe, und dies auch deutlich zum Ausdruck
gebracht, indem man dem Akt der Verbalisierung eine
eigenständige Sphäre zugewiesen hat.
Aus sachlichen Erwägungen heraus spricht eigentlich nichts gegen eine solche Erweiterung bzw. Übertragung auch auf den übrigen Fächerkanon. Auf diese Weise wird einerseits der Bedeutung der Versprachlichung Rechnung getragen, zum anderen bildet dies eine Grundlage für eine erweiterte Matrix zur Beschreibung didaktisch relevanter Möglichkeiten.
|
SPRACHE |
Verbalisierung |
Überführung in Sprache (mdl./schriftl.) |
|
HANDLUNG |
Enaktivierung |
Überführung in Handlung |
|
BILD |
Ikonisierung |
Überführung in Bilder |
|
SYMBOL |
Formalisierung |
Überführung in Symbole |
Abb. 3: Matrix didaktischer Handlungsmuster
Die Schwierigkeiten, die mit der Verbalisierung im Unterricht auftauchen, haben vielleicht auch etwas mit dem komplexen Vorgang zu tun, wie die Sprachäußerungen beim Menschen zustande kommen. Noch immer umgibt die Einzigartigkeit des menschlichen Kommunik ationsmittels eine Aura des Geheimnisvollen, und in der Tat sind die Ergebnisse der entsprechenden Forschung von einem auch nur annähernd als gesichert zu nennenden Kenntnisstand weit entfernt. Die Sprachproduktion wird im ohnehin schon komplexen Organ Ge hirn quasi in separaten Abteilungen „zusammengezimmert“: Allein die Antwort auf eine simple Frage des Lehrers nach der Farbe einer Kreide, die er hochhält, löst eine komplizierte Reaktionskette aus:

Abb. 3: Sprache und Hirnanatomie
Die Frage wird in der Hörrinde (1) akustisch wahrgenommen, die visuelle Komponente dagegen in der Sehrinde (2) , im Schläfenlappen (3) werden Seh- und Hörinformation integriert, schließlich wird das „Lexikon“ der Inhaltswörter (4) nach geeigneten Wörtern a bgesucht, die mögliche Antwort grammatikalisch unter Hinzufügung der Funktionswörter in Form (5) und über den motorischen Cortex (6) schließlich zur Artikulation gebracht: „Die Kreide ist blau!“
Daß vom Mißverstehen der Frage wegen der ungenügend klaren Fragestellung des Lehrers, über schlechte Sichtverhältnisse, defizitärem Bestand des „Lexikons“ und Stockungen in der „Grammatik-Maschine“, bis hin zu Beeinträchtigungen der Sprach- und sonstiger Motorik sich genügend Möglichkeiten für eine fehlerhafte Sprachproduktion auf Seiten der Schüler eröffnet, versteht von selbst.
Den Erkenntnissen der Psycholinguistik - jene Abteilung im Wissenschaftskanon, die dem Gehirn beim Zusammenfügen von Sprache auf die Schliche kommen will - verdanken wir die ersten Einblicke in die Werkstatt des Geistes: Tatsächlich läßt sich über indirekt e Beobachtungen (insbesondere durch die Beobachtung von Sprechern und der Analyse von deren Sprechfehlern!) in groben Zügen die Planung eines Satzes nachvollziehen. So ergab sich, daß Inhaltswörter (Substantive, Verben, Adjektive etc.) in der Regel auch n u r mit Inhaltswörtern, die zudem häufig eine ähnliche Bedeutung haben, vertauscht werden (z.B. schreib das bitte an die Wand! statt: schreib das bitte an die Tafel) und nie mit Funktionswörtern (Artikel, Präpositionen, Konjunktionen etc.).
„Folglich - so darf man schließen - werden Inhalts- und
Funktionswörter wohl in verschiedenen Schritten in die geplante
Äußerung eingesetzt. Und da sich die Funktionswörter
(etwa der Artikel) erst richtig einsetzen lassen, wo die
Inhaltswörter bereits fest stehen, ist auch klar, in welcher
Reihenfolge das geschieht: erst Inhaltswörter, dann
Funktionswörter“ (ZIMMER 1995, S. 84).
„Basisarbeit für die Hochkultur“ (RING)
Die Anstrengungen zur Förderungen eines
adäquaten mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs
erscheinen tatsächlich häufig eher Kärrnerarbeit zu
sein - und vielfach wirkungslos: Bei Kindern im Vorschulalter
müssen zunehmend Sprachentwicklungstörungen fes tgestellt
werden, die nicht nur eine schlechte Ausgangsbasis für das
Lesen- und Schreibenlernen darstellen, sondern leider auch
„für die begleitende intellektuelle Entwicklung, die
untrennbar mit dem Entstehen einer eigenen Sprache und Ausdruckswelt
verbu n den ist“ (RING 1996, S. IV). Die Folge: Immer mehr
Schüler verlassen die Regelschulen ohne ausreichende Lese-,
Schreib- und Sprachfähigkeit. Die vielgelobte neue
Multimedia-Welt hilft aus diesem „Schlamassel“ leider nicht
heraus, enthebt uns gerade nicht d er Mühen: „Es ist
mittlerweilen klar, daß die Nutzung der Möglichkeiten, die
die neuen Informationssysteme - egal ob Online odere Offline -
bieten, niemanden in den Schoß fallen, sondern im Gegenteil ein
hohes Maß an Denkvermögen, analytischen Fähigkeit en
und Urteilskraft, kurzum: einen geschulten und geordneten Verstand
voraussetzen. Und wir wissen auch, daß die wichtigsten Schritte
auf dem Weg zum Erwerb dieser „Schlüsselqualifikation“
die Entwicklung von Sprachvermögen und Lesefähigkeit, somit
langerp rob te Kulturtechniken sind: Entwicklungsmarken, die nicht
übersprungen werden können“ (RING 1996, S. IV)
Anmerkungen:
1) Terminus, den Basil BERNSTEIN zur Kennzeichnung
einer sog. Unterschichtssprache eingeführt hat, die sich durch
eine einfache und starre Syntax, ein begrenztes Vokabular,
verkürzte und unverbundene Sprechweise und der Vermittlung
primär konkreter Bedeutu ngen auszeichnet.
2) aus: KIRCHBERGER, J.H. (1986). Das große
Sprichwörter Buch. München: Orbis.
3) Die Drehbewegung beider Hände erfolgt
gleichsinnig, lediglich die Drehachsen sind verschoben. Im
übrigen ein Beispiel dafür, wie der erste Blick zu
täuschen vermag, und erst die Analyse den Sachverhalt erhellt.
Literatur:
ARBEITSGEDÄCHTNIS. Integration verschiedener gedächtnispsychologischer Hypothesen. Ein DFG-Projekt unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Bredenkamp. Online im Internet: URL
BINDER, G. (1995). Sprachkultur und Umgangskultur in der Schule. In: Pädagogische Welt 12/95, S. 538-543.
HOLE, V. (1973). Erfolgreicher Mathematik-Unterricht. Freiburg.
KORDMANN, G.: Sprache, was ist das
eigentlich?
Online im Internet: URL
LEVELT, W.J.M. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge: MIT Press.
PETERSSEN, W.H. (1994). Anschaulich unterrichten: Ein Lern- und Arbeitsbuch. München: Ehrenwirth.
POPPER, K.R. & ECCLES, J.C. (1996). Das Ich und sein Gehirn.(5. Aufl.). München: Piper.
RING, K. (1996). Basisarbeit für die Hochkultur: Sprachvermögen und Lesefähigkeit-Schlüsselqualifikation für die intelligente Nutzung der neuen Medien. in: Beilage der Süddeutschen Zeitung Nr. 133. 12. Juni 1996, S. IV.
ZIMBARDO, P. G. (1992). Psychologie. (5. Aufl.). Berlin u.a.: Springer.
ZIMMER, D.E. (1995). So kommt der Mensch zur Sprache. Über Spracherwerb, Sprachentstehung und Sprache & Denken. (2.Aufl.). München: Heyne.
Kritik, Anmerkungen etc. an:
Werner Brandl M.A.
Staatsinstitut für die
Ausbildung von Fachlehrern
- Abteilung II -
Am Stadtpark 20
D-81243 München
Quelle: http://www.stif2.mhn.de/sprache.htm